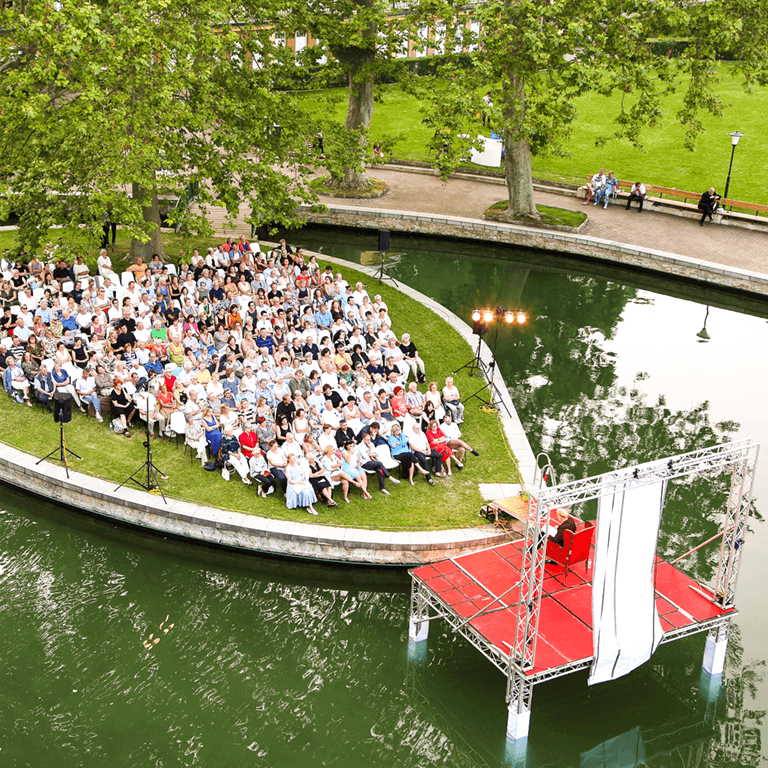Aufführung am 13. Februar 2022, Foto: Matthias Horn
Inszenierung: Martin Kusej, Bühne: Annette Murschetz, Kostüme: Heide Kastler
Vorweg gleich einmal ist zu melden: Ab der 10. Reihe Parkett versteht man die Schauspieler nur bruchstückhaft. Daher rate ich allen, die sich das Stück ansehen wollen, vorher Schiller im Original zu lesen. Ich kenne das Stück gut, hatte dennoch Schwierigkeiten zu erraten, welche Szene gerade gespielt wird. Wozu hat man gute Schauspieler, Schauspielerinnen, wenn sie mit Ausahme von Minichmayr und Galke den Zuschauerraum akustisch nicht ausfüllen können? Auf der Perner Insel mag es diese Schwierigkeiten nicht gegeben haben, da der Raum viel kleiner ist. Warum hat man das Stück nicht in die Akademie verlegt?
Die Folge dieser sprachlich-akustischen Schwierigkeit ist LANGEWEILE! Und das immer gleiche, nichtssagende Bühnenbild ist auch nicht gerade aufregend. Die Inszenierung vergeigt einfach die emotionalen Höhepunkte, die Schiller in das Drama eingeschrieben hat. Kusej inszeniert, als ob er bei Brecht in die Lehre gegangen wäre: Gefühle gehören nicht ins Theater, der Zuschauer soll denken, nicht fühlen. So bleibt selbst die von Schiller hochdramatisch gestaltete Szene der Begegnung der beiden Königinnen auf der Strecke. Nichts von zurückgestautem Hochmut seitens Maria Stuart, die Elisabeth in die Schranken weist. Nichts von geschockter Gekränktheit der starr stehenden Elisabeth. Die Szene wirkt, als ob beide eine Gerichtsverhandlung spielen. Obwohl sich die Damen Mühe geben, ihrer Figur Charakter anzureden, soweit es der Intendant eben zulässt, wirken beide blass. Sie sind Spielball einer Männergesellschaft – das sollen wohl auch die 25 nackten Männer darstellen, die man/frau abwechselnd von vorne und von hinten bewundern darf. Ein Markenzeichen Kusejs ist es ja, mit einem Aufreger Schlagzeilen zu machen. Waren es bei Tosca die „Umschreibung“ der Oper nach seinem Gutdünken und der schneebedeckte Campingplatz als Bühne, so sind es diesmal die nackten Männer. Und prompt fällt das Feuilleton auf den Trick herein und schreibt begeistert von einer „bildgewaltigen Inszenierung“.
Soweit zu erkennen und zu beurteilen war: Bibiana Beglau gibt eine ziemlich machtlose Königin, die von ihren Höflingen bestimmt wird. Birgit Minichmayr bemüht sich, eine bejammernswerte Maria zu spielen. Dass sie noch immer Männer verführen könnte, glaubt man ihr nicht.Franz Pätzold gibt einen zahmen Mortimer, Rainer Galke einen kreuzbraven Gefangenenwärter, Ilay Tiran einen schleimig-schmierigen Graf Leicester. Dass gerade er am Ende Maria die Beichte abnimmt, ist ein typischer Kusejwitz. Und leider ist das ziemlich wirksame Ende des Stückes auch der Feder des Intendanten zum Opfer gefallen. Im Originial ruft Elisabeth in ihrer Verzweiflung nach Leicester, doch von dem heißt es: „Der Lord lässt sich entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich.“ Und so steht Elisabeth im roten (!) Kleid allein auf weiter Flur, auch die Nackten haben sie verlassen. Das Schlussbild ist das Beste an der Inszenierung.